Kriegslüsterne Aquarelle
Junker erzählt wasserfarbenfroh vom Anfang allen Übels
Junker. Ein preußischer Blues rezensiert von Gerrit Lungershausen
Entwarnung: Die Leser_in, die fürchtet, nun eine authentische Geschichte (Echt! Wahr!! Wirklich!!!) aus der Vor- und Frühzeit des Ersten Weltkriegs zu lesen, kann erleichtert aufatmen. Keine Dokumente im Anhang, keine gezeichnete Biopic-histo-info-edu-fiction, kein Nachwort mit autobiografischem Enthüllungsgestus, sondern blanke Fiktion (nein, auch keine Autofiktion). Alles falsch also, und zugleich alles richtig gemacht. Aber von Anfang an.
Die Erzählung setzt in grauer Vorzeit der eigentlichen Haupthandlung an. Damals. Wir sehen zwei stolze und breitschultrige Deutschordensritter, Lothar und Gomeric, die sich mit botanischem Eifer der Pflanzung einer Lindenallee widmen. Diese führt zum Haupthaus der Protagonistenfamilie und die Leser_in zugleich an die Geschichte heran, denn die Allee stammt mitnichten von beflissenen Baumpflanzern des Deutschen Ordens, wie wir gleich darauf erfahren, sondern aus der Großelterngeneration, die ausgewachsene Bäume aus Schlesien importierte. Bloß eine Story also. Genau wie die Geschichte um das Brüderpaar Ludwig und Oswald, gegensätzlich wie alle Brüder: Ludwig ist der gehorsame und mitfühlende Träumer, mit dem sein rauflustiger und widerspenstiger Bruder wenig anfangen kann. Sie wurden in eine untergehende Welt hineingeboren, die vor allem Ludwig allzu fremd ist. Der übermächtige Vater verwaltet als versehrter Veteran des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 den dynastischen Niedergang, die Mutter erwartet schwindsüchtig im Sanatorium Davos ihren Tod, die Hausmagd Gretchen repräsentiert die Schwundstufe eines einst zahlreichen Personals.
In der Kadettenanstalt erweist sich der jüngere Bruder Ludwig als großes Talent am Gewehr, so dass er nicht in die übergroßen Kavallerie-Hufstapfen seiner angesehenen Familie treten kann, sondern sich des modernen Maschinengewehrs annimmt. Mit großem Eifer studiert er die Funktionsweise des Geräts, lernt die technischen Zusammenhänge kennen, schraubt es auf und wieder zusammen. Daneben sehen die Kavalleristen ganz wie das überholte Symbol einer abgeschlossenen Vergangenheit aus, deren im Rückblick gern romantisierter Krieg nun von den endlosen Salven der Maschinengewehre, den berstenden Schüssen der Tanks zerschmettert wird.
Ludwig widmet sich den Vorbereitungen für eine Militärparade, bei der auch der Kaiser zugegen sein soll. Zur Feier des Tages modernisiert er sein bereits höchst modernes MG und optimiert seine Tödlichkeit, beschleunigt seine Schussfrequenz. Die Parade scheint ihm nun optimaler Anlass zu sein, dies auszuprobieren: Während die Entourage des Kaisers feierlich vor seinen Augen vorbeizieht, richtet er die Gewalt, die er an der Kadettenanstalt gelehrt worden ist, gegen den Kaiser selbst und tötet ihn mit einer Salve aus seinem MG. Soweit die Story, fiktiv bis zur letzten Patrone.
Auch in den Zeichnungen schlägt sich diese Gestaltungsabsicht nieder, die Umgebung nicht naturalistisch ab-, sondern künstlerisch nachzubilden. Die Aquarelle sind alles andere als farbenfroh Grau-Blau in Grau-Blau gehalten (nennt sich ja auch »Preußischer Blues«), kontrastreich einzig durch die schablonenhaften Weißflächen, die geschickt eingesetzt werden, um Elemente hervorzuheben. Grafisch besonders gelungen sind die Imaginationsszenen, in denen der Vater als Deutschordensritter daherkommt, der Kaiser überlebensgroß erscheint oder Ludwig durch das Innere des Maschinengewehrs klettert. Dass die Figuren, deren Individualität nicht von Bedeutung ist, mit stereotypen Cartoon-Gesichtern gezeichnet werden, ist konsequent und wird insbesondere bei den Kadetten effektvoll eingesetzt.
In den Jubiläumsjahren zum Ersten Weltkrieg sind zahllose Comics über den Great War von 1914–18 erschienen. Joe Sacco, der Urvater der Reportage-Comics (Palestinä, 1996; Bosnien, 1998) hat mit Die Schlacht an der Somme (2014) ein monumentales Kriegspanorama gezeichnet, dem ganz wörtlich die Worte fehlen, bis auf ein historiografisches Beiheft (echt!). Natürlich ist auch Remarques Bestseller Im Westen nichts Neues (1929) als Comic umgesetzt worden. Für dieses Projekt (2014) ist der Zeichner Peter Eickmeyer eigens zu Recherchezwecken nach Flandern gereist (wahr!). Demgegenüber geht Simon Spruyt erfreulich unbefangen mit der Wirklichkeit um. Die Familie von Schlitt um den Schützen Ludwig und den Kavalleristen Oswald ist nicht historisch verbürgt und der Kaiser hat den Kriegsausbruch realiter überlebt. Wie der Klappentext so treffend schreibt: »So ist es geschehen. Oder doch so ungefähr.« So wie die Geschichte um die Deutschordensbrüder des Prologs eine Fiktion in der Fiktion ist, macht auch die Story um die von Schlitts keinen Hehl daraus, dass sie erfunden ist, wenn auch um Repräsentativität bemüht. Mit Erfolg, denn die Endzeit deutschen Kaisertums am Vorabend des Ersten Weltkriegs ist Spruyt beeindruckend gut gelungen. Die Figuren werden mit elterlichen Erwartungen und staatlichem Drill überfordert, von der Last überlieferter Geschichte und überfrachteter Tradition erdrückt und von der zyklisch wiederkehrenden Gewalt schließlich vernichtet: Die letzten Seiten zeigen das Grauen des Grabenkriegs. Dass der Erzähler am Ende des Comics noch einmal zum Anfang zurückkehrt (»also noch mal von vorn«) und wieder die Lindenallee ins Bild setzt, lässt die Leser_in verstehen, dass wir die Geschichte (und zwar nun wirklich: story und history) sorgsam lesen sollen, damit wir nicht in die Gefahr geraten, das eine mit dem anderen zu verwechseln.
Dieser Comic ist echt gut konzipiert, wahrhaft meisterlich erzählt und visuell wirklich beeindruckend. Ganz ohne historiografische Erklärungen.
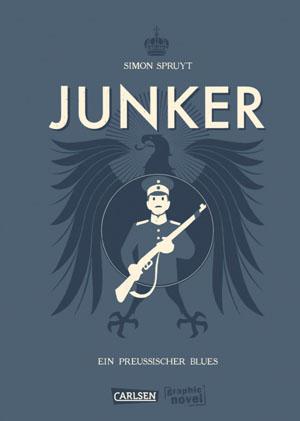 Junker
Junker
Ein preußischer Blues
Simon Spruyt
Übers. v. Rolf Erdorf
Hamburg: Carlsen, 2016
192 S., 24,99 Euro
ISBN 978-3-551-76320-4

